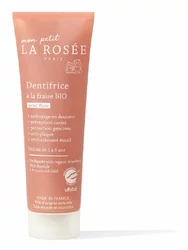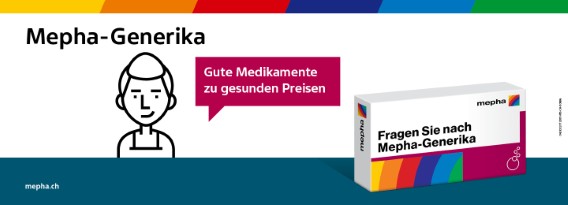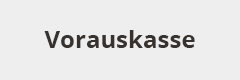Das macht Sie sogar noch klüger
Das macht Sie sogar noch klüger
Was sind Fette?
Fette gehören neben Kohlenhydraten und Eiweissen zu den Grundnährstoffen, die unser Körper aus der Nahrung gewinnt. Sie zeichnen sich durch ihren hohen Energiegehalt aus. Mit rund 9 Kilokalorien pro Gramm liefern sie mehr als doppelt so viel Energie wie Proteine oder Kohlenhydrate. Aufgrund dieser Eigenschaft wurden Fette lange Zeit in Verruf gebracht – vor allem im Hinblick auf Gewichtszunahme. Doch diese Sichtweise greift zu kurz, denn die Bedeutung von Fett reicht weit über den Kaloriengehalt hinaus.
Man unterscheidet zwischen tierischen und pflanzlichen Fetten, die sich in ihrer Zusammensetzung teils deutlich unterscheiden. Während tierische Produkte wie Butter, Fleisch oder Käse tendenziell mehr gesättigte Fettsäuren enthalten, sind Pflanzenquellen wie Nüsse, Samen, Avocados und Pflanzenöle häufig reich an ungesättigten Fettsäuren. Eine besondere Rolle nehmen fette Fische wie Lachs oder Makrele ein. Sie zählen zwar zu den tierischen Quellen, enthalten aber dennoch viele gesundheitsfördernde Omega-Fettsäuren.
Welche Funktionen haben Fette im Körper?
Fette übernehmen im menschlichen Körper zahlreiche lebenswichtige Aufgaben, die weit über ihre Funktion als Energielieferanten hinausgehen. Aufgrund ihrer hohen Kaloriendichte sind sie eine besonders effiziente Energiequelle und ermöglichen zugleich die Speicherung überschüssiger Energie in Form von Depotfett. Dieses Reservefett steht dem Körper bei längerer körperlicher Belastung oder in Zeiten eingeschränkter Nahrungsaufnahme zur Verfügung.
Darüber hinaus sind Fette unerlässlich für die Aufnahme fettlöslicher Nährstoffe. Nur in Verbindung mit Fett kann der Körper die Vitamine A, D, E und K aus der Nahrung verwerten. Sie erfüllen wichtige Funktionen, beispielsweise für den Zellschutz, das Immunsystem, die Blutgerinnung und die Knochengesundheit.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Versorgungmit essenziellen Fettsäuren. Da der Körper sie nicht selbst herstellen kann, müssen sie über die Nahrung aufgenommen werden. Sie sind für die Bildung und Funktionsfähigkeit von Zellmembranen notwendig, beeinflussen den Fettstoffwechsel und tragen zur Regulation von Entzündungsprozessen sowie zur Senkung erhöhter Cholesterinwerte bei. Vor allem Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungshemmend und verbessern die Fliesseigenschaften des Blutes.
Fette sind ausserdem wichtige Bausteine der Zellstruktur. Die Membranen aller Körperzellen bestehen zu einem grossen Teil aus Lipiden, die deren Stabilität sichern und den Austausch von Stoffen kontrollieren. Auch bei der Bildung bestimmter Hormone spielen Fette eine entscheidende Rolle: aus Cholesterin entstehen beispielsweise Steroidhormone wie Östrogen, Testosteron oder Cortisol, die vielfältige Stoffwechselvorgänge steuern. Zusätzlich produziert das Fettgewebe hormonähnliche Substanzen wie Leptin, welches das Hungergefühl beeinflusst.
Auch für die äussere Schutzfunktion des Körpers sind Fette von grosser Bedeutung. Unter der Haut fungieren sie einerseits als Isolationsschicht gegen Kälte und andererseits als Polsterung für empfindliche innere Organe wie Nieren oder Leber. Darüber hinaus sind Fette Träger fettlöslicher Geschmacksstoffe. Viele Aromen entfalten sich erst durch ihre Anwesenheit, weshalb fetthaltige Speisen als besonders geschmackvoll wahrgenommen werden. Das erklärt, warum sehr fettarme Kost häufig als weniger aromatisch wahrgenommen wird.
Welche Fettquelle verwenden Sie heute am häufigsten?
Was sind gesättigte und ungesättigte Fettsäuren?
Fettsäuren sind die zentralen Bausteine von Fetten. Je nach chemischem Aufbau unterscheiden sie sich deutlich voneinander, insbesondere im Hinblick auf ihren Sättigungsgrad. Diese Eigenschaft hat nicht nur Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften des Fettes, sondern auch auf dessen Wirkung im Körper.
Gesättigte Fettsäuren haben eine eher starre Struktur. Deshalb sind sie bei Zimmertemperatur meist fest, wie es etwa bei Butter oder Kokosfett der Fall ist. Sie stecken vor allem in Tierprodukten wie Fleisch, Wurst, Käse und Sahne, aber auch in einigen pflanzlichen Fetten wie Palmöl. Der Körper kann sie selbst herstellen, sodass sie nicht über die Ernährung zugeführt werden müssen. Wer allerdings regelmässig zu viel davon bekommt, kann seine Blutfettwerte verschlechtern, insbesondere den Anteil des sogenannten „schlechten” LDL-Cholesterins. Das kann die Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen langfristig erhöhen.
Ungesättigte Fettsäuren haben eine besondere Struktur, die sie beweglicher macht. Deshalb sind sie bei Zimmertemperatur meist flüssig, wie beispielsweise Olivenöl. Man unterscheidet zwischen einfach ungesättigten Fettsäuren, wie sie in Olivenöl vorkommen, und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die beispielsweise in Nüssen, Samen oder fettem Fisch enthalten sind. Zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren zählen unter anderem die wertvollen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Sie müssen über die Nahrung aufgenommen werden und spielen eine wichtige Rolle für ein gesundes Herz, Gehirn und Zellen.
Transfettsäuren stellen einen Sonderfall dar. Sie gehören zwar chemisch zu den ungesättigten Fettsäuren, besitzen aber eine veränderte räumliche Struktur. Diese kann durch industrielle Prozesse oder starkes Erhitzen entstehen. Diese Form hat ungünstige gesundheitliche Effekte, da sie die Blutfettwerte verschlechtern und Entzündungen begünstigen kann.
editorial.facts
- Fette lassen sich in mehr als 500 verschiedene Typen einteilen, darunter einfache Lipide (die im menschlichen Körper am häufigsten vorkommen), komplexe Lipide und sogenannte Lipidderivate.
- Unser Gehirn besteht zu etwa 60 Prozent aus Fett – ein guter Grund, hochwertige Speisefette nicht zu meiden. Besonders Omega-3-Fettsäuren unterstützen die geistige Leistungsfähigkeit.
- Eine Tiefkühlpizza enthält im Schnitt rund 33 Gramm Fett – das entspricht bei vielen Menschen bereits fast der Hälfte der empfohlenen Tagesmenge.
Kann ich auf Fett verzichten?
Ein völliger Verzicht auf Fett in der Ernährung ist nicht ratsam, da Fett eine unverzichtbare Rolle für die Gesundheit spielt. Viele Diäten setzen auf eine reduzierte Fettzufuhr, etwa im Rahmen einer Low-Fat-Ernährung, um die tägliche Kalorienaufnahme zu senken und dadurch Gewicht zu verlieren. Dabei wird empfohlen, fettreiche Lebensmittel durch fettärmere Alternativen zu ersetzen und bevorzugt fettarme Garmethoden wie Dünsten oder Grillen zu wählen.
Allerdings zeigt sich, dass eine stark fettarme Ernährung auch Nachteile mit sich bringen kann. Wer Fett zu stark einschränkt, riskiert eine unzureichende Versorgung mit essenziellen Fettsäuren und fettlöslichen Vitaminen wie A, D, E und K.
Statt Fett vollständig zu meiden, sollte daher ein ausgewogenes Verhältnis angestrebt werden. Eine bewusste Auswahl an Lebensmitteln mit möglichst wenig versteckten Fetten, aber ausreichend „guten” Fettquellen ist sinnvoller und nachhaltiger als eine strikte Reduktion. Kurz gesagt: auf Fett gänzlich zu verzichten, ist nicht nur unnötig, sondern kann sogar gesundheitliche Risiken mit sich bringen.
Öle und Fette: Was ist der Unterschied?
Der zentrale Unterschied zwischen Ölen und Fetten liegt in ihrer Konsistenz bei Raumtemperatur: Öle sind flüssig, Fette hingegen fest oder streichfähig. Diese Eigenschaft hängt vom Schmelzpunkt ab, der durch die Art der enthaltenen Fettsäuren bestimmt wird. Öle bestehen überwiegend aus ungesättigten Fettsäuren, die eine flüssige Struktur begünstigen. Feste Fette enthalten dagegen meist einen höheren Anteil an gesättigten Fettsäuren, wodurch sie bei normalen Temperaturen härter werden.
Unabhängig davon, ob der Ursprung pflanzlich oder tierisch ist, gilt: Oliven-, Raps- oder Sonnenblumenöl zählen zu den Ölen, während Butter, Kokosfett oder Margarine zu den festen Fetten gehören. Einige Pflanzenöle, beispielsweise aus der Ölpalme oder Kokospalme, sind bei kühleren Temperaturen ebenfalls fest, obwohl sie technisch gesehen Öle sind. Sie wurden nicht gehärtet, sondern sind von Natur aus bei unseren Breitengraden streichfähig.
Die Lebensmittelindustrie kann zusätzlich flüssige Öle gezielt härten, um sie streichfähig zu machen. Dabei entstehen Trans-Fettsäuren, die aus gesundheitlicher Sicht problematisch sein können. Entsprechende Hinweise finden sich in Zutatenlisten unter Begriffen wie „gehärtetes Fett“ oder „hydriert“.
Wie viel Fett braucht mein Körper pro Tag?
Der tägliche Fettbedarf hängt in erster Linie vom individuellen Energieverbrauch ab. Dieser setzt sich aus verschiedenen Faktoren wie Körpergrösse, Geschlecht, Alter und Aktivitätsniveau zusammen. Allgemein gilt: Fett sollte etwa 20 bis 30 Prozent der gesamten Kalorienzufuhr ausmachen. Je nach Energiebedarf ergibt sich daraus eine empfohlene Fettmenge von 60 bis 80 Gramm pro Tag. Bei einem moderaten Kalorienverbrauch von 1'800 Kilokalorien sind rund 60 Gramm Fett sinnvoll, während bei einem höheren Verbrauch von etwa 2’000 Kilokalorien bis zu 70 Gramm angemessen erscheinen.
Entscheidend ist jedoch nicht nur die Fettmenge, sondern vor allem die Fettqualität. Besonders gesund sind ungesättigte Fettsäuren, die unter anderem in pflanzlichen Ölen, Avocados, Samen und fettem Fisch enthalten sind, da sie Herz und Stoffwechsel unterstützen. Gesättigte Fette aus tierischen Produkten sollten dagegen auf maximal zehn Prozent der Kalorien begrenzt werden. Transfette aus stark verarbeiteten Lebensmitteln sind besonders schädlich und sollten komplett vermieden werden.
So profitieren Sie von Fetten: hilfreiche Tipps
- Integrieren Sie pro Mahlzeit eine Daumenportion Fett, beispielsweise in Form von Olivenöl im Salat, Lachs oder Nüssen. So fördern Sie die Aufnahme der fettlöslichen Vitalstoffe A, D, E und K.
- Sowohl bei einer Low-Carb- als auch bei einer mediterranen Ernährung sollten Sie vor allem einfache Zucker und stark verarbeitete Kohlenhydrate reduzieren und nicht das Fett. Wählen Sie dabei gezielt hochwertige Pflanzenöle, die reich an gesunden, ungesättigten Fettsäuren sind, wie beispielsweise Leinöl, Hanföl oder Walnussöl.
- Achten Sie beim Einkauf auf kaltgepresste, unraffinierte Öle in dunklen Flaschen, da diese besonders reich an ungesättigten Fettsäuren sind und empfindlich gegenüber Licht und Hitze reagieren.
- Verwenden Sie mehrfach ungesättigte Öle wie Leinöl oder Walnussöl ausschliesslich kalt, beispielsweise als Zugabe zu Salaten, Dips oder gedünstetem Gemüse, da sie bei Hitze schnell oxidieren.
- Vermeiden Sie versteckte Fette in Fertiggerichten, Knabbereien und Süssigkeiten, indem Sie sich für frische, unverarbeitete Lebensmittel entscheiden.
- Beim Braten genügt ein Teelöffel Öl, den Sie mit einem Pinsel in der Pfanne verteilen. Das spart Kalorien, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen.
- Garen Sie Speisen im Ofen, Wok oder Dampfgarer statt sie zu frittieren, um den Fettgehalt Ihrer Mahlzeiten gering zu halten, ohne auf Genuss zu verzichten.
- Bevorzugen Sie pflanzliche Aufstriche aus Nüssen, Linsen oder Avocados anstelle von Käse oder Wurst auf dem Brot, um die Zufuhr gesättigter Fette zu senken und mehr Ballaststoffe aufzunehmen.
- Essen Sie ausserdem regelmässig fetten Fisch wie Lachs, Sardinen oder Hering, um Ihren Bedarf an Omega-3-Fettsäuren zu decken. Diese sind wichtig für Ihre Herzgesundheit, Ihr Gehirn und zur Hemmung von Entzündungen.
- Bevorzugen Sie Lebensmittel mit Nahrungsfetten auf Pflanzenbasis, wie Lein- oder Rapsöl, da diese reich an der gesunden Linolensäure (Omega-3) und arm an der entzündungsfördernden Linolsäure (Omega-6) sind. Das hilft, den Cholesterinspiegel zu senken und ungesunde Fette zu vermeiden.
- Lesen Sie bei verarbeiteten Lebensmitteln die Zutatenliste sorgfältig, um versteckte Fette, insbesondere gehärtete Fette oder Palmöl, frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls zu meiden.
Fett zu vermeiden bedeutet nicht automatisch, gesund zu leben. Vielmehr kommt es darauf an, die richtigen Fette in der passenden Menge in den Speiseplan zu integrieren.