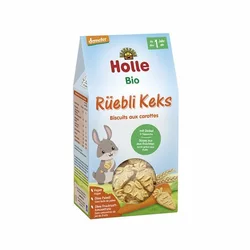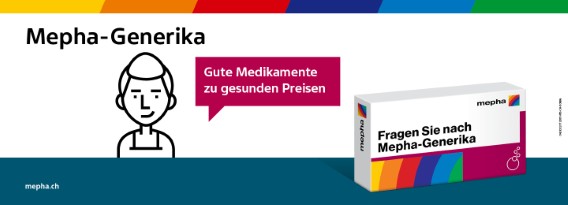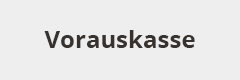Hitze
Damit überstehen Sie die Hölle auf Erden
Was ist Hitze?
Hitze bezeichnet die subjektiv empfundene Erhöhung der Umgebungstemperatur, die von vielen Menschen als unangenehm oder belastend empfunden wird. Oft wird Hitze mit Wärme verwechselt, doch aus physikalischer Sicht handelt es sich um unterschiedliche Konzepte. Hitze bezeichnet den Zustand, der durch die Temperatur beschrieben wird. Wärme ist dagegen eine Energieform, die durch einen Temperaturunterschied zwischen einem System und seiner Umgebung transportiert wird.
Wenn die Aussentemperatur steigt und der Körper mehr Wärme aufnimmt, als er durch seine natürlichen Kühlmechanismen abgeben kann, kann dies problematisch werden. Die Körpertemperatur steigt und das Risiko von Hitzestress wächst. Besonders bei Temperaturen über 30 °C haben viele Menschen in Mitteleuropa grössere Schwierigkeiten, ihre Körpertemperatur selbst zu regulieren. Je nach Gesundheitszustand, Alter und Gewöhnung an Hitze kann dies zu gesundheitlichen Gefahren führen.
Was passiert bei Hitze im Körper?
Wenn der Körper hohen Aussentemperaturen ausgesetzt ist, reagiert er mit verschiedenen physiologischen Mechanismen, um die Körpertemperatur stabil zu halten. Eine der ersten Reaktionen ist die Erweiterung der Blutgefässe, was zu einer stärkeren Durchblutung der Haut führt. Dadurch kann überschüssige Körperwärme abgegeben werden. Dies hat jedoch auch zur Folge, dass der Blutdruck sinkt, was sich negativ auf die körperliche Leistungsfähigkeit auswirken kann.
Ein weiterer wichtiger Prozess ist das Schwitzen. Der Körper scheidet Schweiss aus, um die Haut zu befeuchten. Durch die Verdunstung des Schweisses wird Körperwärme abgeführt, wodurch der Körper gekühlt wird. Dabei ist es jedoch entscheidend, ausreichend Flüssigkeit und Elektrolyte zu sich zu nehmen, da der Körper bei starkem Schwitzen wichtige Mineralstoffe verliert.
Eine hohe Luftfeuchtigkeit stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, wird die Verdunstung des Schweisses erschwert, da die Luft bereits mit Wasser gesättigt ist. Dies beeinträchtigt den Kühlmechanismus und führt dazu, dass der Körper weniger effektiv gekühlt wird.
Steigt die Temperatur über 40 Grad Celsius, wird der Körper stark belastet. Ab einer Körpertemperatur von 42 °C kann dies lebensbedrohlich werden, da körpereigene Eiweisse zerstört werden und der Organismus zusammenbrechen kann. Daher ist es wichtig, dass der Körper überschüssige Körperwärme effizient abführt, um diese Extremtemperaturen zu vermeiden.
Wie schützen Sie sich heute vor extremer Sommerhitze?
Wer ist bei Hitze besonders gefährdet?
Bei extrem hohen Temperaturen sind insbesondere Menschen gefährdet, deren Fähigkeit zur Selbstregulation der Körpertemperatur eingeschränkt ist oder die aufgrund von Vorerkrankungen zu einer Risikogruppe gehören. Dazu zählen vor allem ältere Menschen, die oft weniger schwitzen und ein vermindertes Durstgefühl haben. Auch Menschen mit chronischen Erkrankungen, insbesondere des Herz-Kreislauf-Systems, gehören zu den Risikogruppen, da Hitze die Belastung des Kreislaufsystems zusätzlich erhöht.
Darüber hinaus sind Säuglinge, Kleinkinder, pflegebedürftige Menschen und Obdachlose besonders gefährdet, da sie sich in der Regel weniger gut vor Hitze schützen können. Ebenso anfällig sind Personen, die körperlich schwer arbeiten oder sich im Freien aufhalten, da ihre Körpertemperatur schneller ansteigt.
Auch bestimmte Medikamente wie Diuretika oder Antidepressiva können eine Rolle spielen, da sie die Fähigkeit des Körpers zur Kühlung verringern. Zudem sind auch Personen ohne Vorerkrankungen nicht vor Hitzebelastung sicher, insbesondere wenn sie sich stark anstrengen, Alkohol konsumieren oder Drogen einnehmen. Dies kann die Anpassungsfähigkeit des Körpers beeinträchtigen.
editorial.facts
- Die heisseste Zeit des Tages ist nicht zur Mittagszeit, sondern zwischen 16 und 17 Uhr, wenn der Boden seine maximale Temperatur erreicht hat und die aufgestaute Hitze von Strassen und Dächern abgegeben wird.
- Ein Sommertag beginnt bei 25 °C, ein Hitzetag bei 30 °C.
- Bei windstillem Wetter und kaum sinkenden Temperaturen nachts kann es gefährlich werden. In heissen Regionen kühlt es nachts jedoch oft merklich ab, sodass eine Erholung möglich ist.
- In geparkten Autos kann die Temperatur an heissen Tagen auf bis zu 60 °C steigen. Dies kann zu einem Hitzschlag führen, wenn die Körpertemperatur 41 °C erreicht. Deshalb sollten Sie niemals Kinder, gesundheitlich eingeschränkte Personen oder Tiere im Auto zurücklassen.
Hat extreme Hitze einen Einfluss auf die Psyche?
Es ist nachgewiesen, dass sich extreme Hitze negativ auf diepsychische Gesundheit auswirkt. Studien zeigen, dass sie das Risiko für psychische Beschwerden wie Angstzustände und depressive Verstimmungen erhöht. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, sozial benachteiligte Gruppen sowie Personen mit bestehenden psychischen Erkrankungen. Denn die Belastung durch Hitze kann bestehende Symptome verstärken. Zudem steigt bei anhaltender Hitze das Aggressionspotenzial, was mit einer Zunahme von Gewaltverhalten in Verbindung gebracht wird.
Auch die kognitive Leistungsfähigkeit wird durch hohe Temperaturen beeinträchtigt. Ein weiterer möglicher psychischer Effekt ist die sogenannte Klimaangst, ein Zustand innerer Anspannung und Besorgnis angesichts der Klimakrise. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit kann zu einer vermehrten Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol führen. Langfristig könnte dies depressive Entwicklungen begünstigen.
Zusätzlich können starke Temperaturschwankungen Sommerdepressionen verschlimmern. Diese Form der saisonalen Depression tritt zwar seltener auf als die Winterdepression, wird jedoch unter anderem mit Schlafstörungen, Reizbarkeit und einer gestörten Melatoninproduktion in Verbindung gebracht.
Welche Krankheiten entstehen durch Hitze?
Bei extremer Hitze können verschiedene gesundheitliche Probleme unterschiedlicher Schweregrade mit unterschiedlichen Symptomen auftreten. Eine häufige Folge ist der Sonnenstich, der auftritt, wenn der Kopf zu lange direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, ohne durch eine Kappe oder einen Hut geschützt zu werden. Typische Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Fieber sowie in schweren Fällen Bewusstseinsstörungen und Krampfanfälle.
Ein weiterer schwerwiegender Zustand ist der Hitzschlag. Er entsteht, wenn die Fähigkeit des Körpers, durch Schwitzen die Temperatur zu regulieren, überfordert ist. Dies führt zu einem schnellen Anstieg der Körpertemperatur auf über 40 °C. Ein Hitzschlag kann zu Bewusstseinsveränderungen, Bewusstlosigkeit und Hirnschwellung führen und erfordert sofortige medizinische Hilfe.
Ein Hitzekollaps wird insbesondere durch langes Stehen bei starker Hitze verursacht und führt zu einem schnellen Blutdruckabfall. Dies kann zu Schwindel, Schwäche und in einigen Fällen auch zu Bewusstlosigkeit führen. Besonders gefährdet sind Menschen mit Erkrankungen von Herz und Blutgefässen oder solche, die Diuretika einnehmen.
Hitzekrämpfe entstehen häufig nach körperlicher Anstrengung bei hohen Temperaturen. Durch das übermässige Schwitzen verliert der Körper wichtige Elektrolyte, was zu schmerzhaften Muskelkrämpfen, insbesondere in den Beinen, Armen oder im Unterleib, führen kann.
Weitere Hitzeerkrankungen sind der Hitzeausschlag, der durch verstopfte Schweissdrüsen verursacht wird und sich durch kleine, juckende Bläschen äussert, sowie die Hitzepickel, die durch verstopfte Talgdrüsen entstehen. Sie treten vor allem bei zu enger oder wenig atmungsaktiver Kleidung auf. Hitzebedingte Ödeme, die vor allem die Unterschenkel betreffen, entstehen durch eine Erweiterung der Blutgefässe sowie eine verstärkte Rückhaltung von Wasser und Salz im Körper.
Wie Sie sich vor Hitze schützen können: praktische Tipps
- Trinken Sie während einer Hitzewelle mindestens 2-3 Liter Flüssigkeit täglich. Am besten eignen sich kühle, aber nicht eiskalte Getränke wie Wasser, Kräutertee oder Saftschorlen. Vermeiden Sie zu kalte Getränke, da diese den Körper zum Schwitzen anregen und so zu einer zusätzlichen Wärmeentwicklung führen können.
- Reduzieren Sie fettreiche, schwer verdauliche Mahlzeiten und setzen Sie auf leicht verdauliche Kost wie Salate, Gemüse, wasserreiches Obst (z. B. Melonen, Gurken) und Vollkornprodukte. Diese Lebensmittel helfen, den Flüssigkeitshaushalt zu regulieren und bieten zugleich Vitamine und Mineralstoffe.
- Tragen Sie luftige, helle Kleidung aus natürlichen Stoffen wie Baumwolle oder Leinen, welche die Haut atmen lässt und den Körper kühl hält. Dunkle Farben absorbieren mehr Sonnenstrahlen – vermeiden Sie diese im Sommer, um eine Überhitzung zu verhindern. Schützen Sie Kopf und Augen mit einem breitkrempigen Hut und einer Sonnenbrille mit UV-Schutz.
- Um die Raumtemperatur unter 26°C zu halten, verdunkeln Sie tagsüber die Fenster und vermeiden Sie Wärmequellen wie Backöfen oder Elektrogeräte. Lüften Sie morgens und abends, wenn es draussen kühler ist, und nutzen Sie einen Ventilator, um die Luftzirkulation zu verbessern.
- Tragen Sie regelmässig Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens SPF 30) auf alle exponierten Hautstellen auf, um Sonnenbrand und Hautschäden zu vermeiden. Besonders empfindliche Stellen wie Gesicht und Nacken benötigen besondere Aufmerksamkeit.
- Duschen Sie statt mit kaltem lieber mit lauwarmem Wasser, um Ihre Poren zu öffnen und Ihre Körperwärme entweichen zu lassen. Auch ein kühles Fussbad oder das Abspülen der Handgelenke und des Nackens mit kaltem Wasser kann eine schnelle Erfrischung bieten.
- Wenn Sie Sport treiben möchten, verschieben Sie Ihr Training auf die kühleren Stunden des Tages. Radfahren, Schwimmen oder Wandern sind ideal, da diese Aktivitäten bei hoher Temperatur weniger belastend für den Körper sind.
- Achten Sie auf den Flüssigkeitshaushalt bei Diabetes: trinken Sie regelmässig, vor allem bei heissem Wetter. Wasser oder ungesüsste Tees sind ideal, während zuckerhaltige Getränke und Alkohol vermieden werden sollten. Achten Sie darauf, Insulin korrekt zu lagern und messen Sie regelmässig Ihren Blutzuckerspiegel.
- Gehen Sie auf grasbewachsenen Flächen oder nutzen Sie Strassen mit Bäumen und Schatten, um die Belastung durch die Hitze der Oberflächen zu verringern. Dies schützt Ihre Füsse und hilft, eine Überhitzung zu vermeiden.
- In den Sommermonaten führen Hitzeperioden und Tropennächte durch den Klimawandel zu deutlich erhöhter Lufttemperatur, wobei besonders die Tagestemperatur stark ansteigt – achten Sie auf Hitzewarnungen, suchen Sie Schatten zur Abkühlung und unterstützen Sie Ihre Wärmeregulation mit regelmässigen Pausen, um Unwohlsein vorzubeugen.
- Wenn Sie oder jemand in Ihrer Nähe Symptome wie Schwindel, Übelkeit oder Verwirrung bemerken, suchen Sie sofort Schatten auf, trinken Sie Wasser und, wenn nötig, kontaktieren Sie den Notdienst.
Um den Herausforderungen der Hitze zu begegnen, ist es unerlässlich, auf den eigenen Körper zu achten und vorbeugende Massnahmen zu ergreifen. Mit der richtigen Vorsorge können wir die Sommerhitze besser ertragen und unsere Gesundheit schützen.