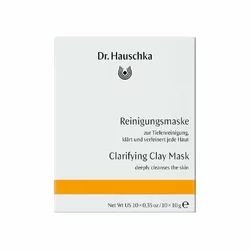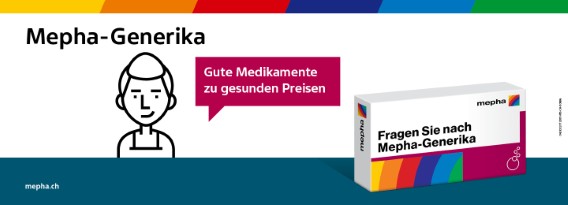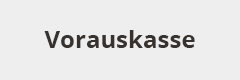Körpergeruch
Oh je, das möchten Sie nicht riechen
Was ist Körpergeruch?
Als Körpergeruch bezeichnet man die Gesamtheit der Düfte, die der menschliche Körper über die Haut abgibt. Dabei handelt es sich um individuelle Geruchsmuster, die bei jedem Menschen unterschiedlich sind und durch zahlreiche Faktoren im Körper geprägt werden. Diese Gerüche können sich je nach Körperstelle, Tageszeit oder äusseren Einflüssen wie Kleidung und Klima unterscheiden. Sie stehen in engem Zusammenhang mit biologischen Vorgängen.
Besonders stark wahrnehmbar ist der Körpergeruch in Regionen wie den Achselhöhlen, an den Füssen, in der Leistengegend oder auf dem Rücken. Dort befinden sich viele Drüsen, die auf natürliche Weise Substanzen abgeben, welche den persönlichen Geruch mitbestimmen. Auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern, Altersgruppen und Lebensphasen spielen dabei eine Rolle.
Wie entsteht Körpergeruch?
Die Entstehung von Körpergeruch ist das Ergebnis mehrerer ineinandergreifender Prozesse, die hauptsächlich auf der Hautoberfläche ablaufen. Dabei spielen bestimmte Hautdrüsen und die natürliche Mikroflora der Haut eine zentrale Rolle.
Die sogenannten ekkrinen Drüsen scheiden eine klare, dünnflüssige Substanz aus, die vor allem der Wärmeregulierung dient. Andere Drüsentypen, insbesondere jene in behaarten Körperregionen wie den Achselhöhlen, produzieren ein reichhaltigeres, komplexeres Sekret. Diese dickflüssige Substanz enthält organische Bestandteile, die sich besonders gut als Nährboden für Mikroorganismen eignen.
Auf der Hautoberfläche leben unzählige Bakterien, die sich an feuchten, warmen Stellen besonders gut vermehren. Diese Mikroorganismen nutzen die in den Hautsekreten enthaltenen Stoffe, wie beispielsweise Eiweisse oder Fette, als Energiequelle. Bei deren Abbau entstehen verschiedene flüchtige Verbindungen, die in die Umgebung abgegeben werden und dort als spezifischer Eigengeruch wahrgenommen werden können.
Dieser Effekt ist besonders deutlich spürbar an Stellen, an denen sich Hitze und Feuchtigkeit stauen, beispielsweise in engen Schuhen, unter synthetischer Kleidung oder unter den Armen. Die dort geschaffenen Bedingungen begünstigen sowohl die Aktivität der Hautdrüsen als auch das Wachstum der Mikroorganismen. Je nach individueller Hautflora und Zusammensetzung des Sekrets können sowohl die Intensität als auch die Geruchsart stark variieren.
editorial.facts
- Neben etwa 99 % Wasser und 0.5 % Salzen enthält Schweiss auch verschiedene Nährstoffe wie Harnstoff, Milchsäure, Eiweisse, Zucker und Fette.
- Ein säuerlicher Essiggeruch kann auf eine Schilddrüsenunterfunktion hinweisen, während ein acetonartiger Geruch, der an Nagellackentferner erinnert, auf Diabetes und Insulinmangel hindeuten kann.
- Auch bei kühlen Temperaturen kann unangenehmer Geruch entstehen, beispielsweise durch Stress, hormonelle Schwankungen oder Erkrankungen.
- Grundsätzlich ist Schwitzen gesund, da es die Körpertemperatur reguliert, beim Ausscheiden von Stoffwechselabfällen wie Harnstoff hilft und durch den kühlenden Effekt das körperliche Wohlbefinden fördert.
Was verursacht den unangenehmen Geruch von Schweiss?
Unter bestimmten Umständen kann Schweiss deutlich intensiver oder unangenehmer riechen. Ein häufiger Auslöser ist eine verstärkte Schweissbildung, beispielsweise bei körperlicher Anstrengung, hohen Temperaturen oder emotionalem Stress. Wird der Schweiss nicht rasch verdunstet oder entfernt, sondern staut sich in luftundurchlässiger Kleidung oder an wenig belüfteten Hautstellen, kann sich ein feuchtwarmes Milieu bilden, das bestimmte Hautreaktionen begünstigt.
Auch die Ernährungsgewohnheiten beeinflussen die Wahrnehmung des eigenen Schweissgeruchs. So können stark gewürzte Speisen, Alkohol oder Knoblauch dazu führen, dass bestimmte Abbauprodukte über die Haut abgegeben werden. Solche Veränderungen sind meist nur vorübergehend, aber deutlich wahrnehmbar. Eine frische, pflanzenbasierte Ernährungsweise kann sich hingegen tendenziell positiv auf den Eigengeruch auswirken.
In bestimmten Lebensphasen wie der Pubertät oder bei zyklusabhängigen Schwankungen können Unterschiede in der Art oder Intensität des Körpergeruchs auftreten. Darüber hinaus kann auch die Einnahme bestimmter Medikamente eine Rolle spielen. Diese können den Stoffwechsel beeinflussen, was sich auf die Zusammensetzung der Ausscheidungen und somit auf die wahrgenommene Duftnote auswirkt.
Was hilft Ihnen heute am besten gegen Körpergeruch?
Wieso riecht Schweiss nach Zwiebeln?
Der zwiebelartige Geruch von Schweiss ist für Betroffene meist sehr unangenehm, jedoch harmlos und hat nachvollziehbare Ursachen. Er entsteht, wenn Bakterien, die auf der Haut leben, bestimmte Bestandteile des Schweisses – vor allem schwefelhaltige Verbindungen – zersetzen. Dabei entstehen flüchtige Stoffe, sogenannte Thiole, die nach Zwiebeln oder Knoblauch riechen.
Dieser Duft ist besonders bei Frauen wahrnehmbar, da ihr Schweiss hormonbedingt mehr Schwefelverbindungen enthält. Männer hingegen entwickeln meist einen eher käsigen bis stechenden Körpergeruch. Dies ist auf den Abbau von Testosteron zurückzuführen.
Auch die Ernährung spielt eine bedeutende Rolle: wer regelmässig zwiebel- oder knoblauchhaltige Speisen verzehrt, scheidet deren ätherische Öle über den Schweiss wieder aus – mit deutlich wahrnehmbarem Ergebnis.
Neben harmlosen Auslösern wie Nahrung und Hormonen können auch Infektionen oder gesundheitliche Störungen eine Rolle spielen. Ein zwiebelartiger Geruch im Intimbereich kann auf eine gestörte Scheidenflora oder eine Pilzinfektion hindeuten und sollte ärztlich abgeklärt werden. Auch eine plötzliche Veränderung des Schweissgeruchs kann in Einzelfällen ein Hinweis auf hormonelle oder stoffwechselbedingte Erkrankungen sein.
Schweiss riecht nach Urin: Wieso passiert das?
Ein unangenehmer, urinähnlicher Schweissgeruch sollte nicht ignoriert werden, denn dahinter können sich ernstzunehmende Prozesse im Körper verbergen. Oft ist Ammoniak die Ursache: werden die Stoffwechselabfallprodukte nicht wie gewohnt über die Nieren ausgeschieden, gelangen sie ins Blut und werden über die Haut oder die Atemluft abgegeben. Dies kann insbesondere bei fortgeschrittenen Nierenerkrankungen der Fall sein. Die Nieren filtern die Schadstoffe dann nicht mehr ausreichend, sodass sie sich im Körper anreichern und auffällige Körpergerüche verursachen – vor allem unter den Achseln, aber auch am Rumpf, im Intimbereich oder an Händen und Füssen.
Auch der Ernährungsstil ist ein wichtiger Faktor. Wer eine sehr kohlenhydratarme Ernährung (z. B. eine No-Carb-Diät) verfolgt oder intensiv trainiert, zwingt den Körper, Energie aus Eiweiss zu gewinnen. Dabei entsteht Ammoniak als Nebenprodukt, das über den Schweiss ausgeschieden wird und für den urinartigen Geruch verantwortlich ist. Darüber hinaus können auch Medikamente Auslöser sein. Einige Präparate, wie bestimmte Antiepileptika oder Hydrocortison-haltige Produkte, können den Ammoniakspiegel im Körper erhöhen und somit den Körpergeruch verändern.
In manchen Fällen kann ein veränderter Körpergeruch auch auf eine Überforderung der Leber hinweisen. Wenn die Entgiftungsfunktion beeinträchtigt ist, können Schadstoffe ebenfalls über die Haut abgegeben werden. Treten zusätzlich Symptome wie chronische Müdigkeit, Bluthochdruck, Atemnot, Wassereinlagerungen oder Übelkeit auf, ist es unbedingt ratsam, einen Arzt zu konsultieren.
So lässt sich Körpergeruch wirksam reduzieren: nützliche Tipps
- Duschen Sie regelmässig, aber mit Bedacht. In der Regel reicht es, sich täglich mit lauwarmem Wasser und milder Seife zu waschen. Zu häufiges Duschen, insbesondere mit heissem Wasser, kann den Säureschutzmantel der Haut schädigen und die Schweissproduktion sogar erhöhen.
- Rasieren Sie Ihre Achselhöhlen, um die Bakterienlast zu senken. Haare binden Feuchtigkeit und bieten Bakterien einen idealen Nährboden – glatte Haut bleibt trockener und hygienischer.
- Verwenden Sie ein Antitranspirant, das wirkt, statt nur zu duften. Achten Sie beim Kauf auf den Hinweis „Antitranspirant“. Im Gegensatz zu einfachen Deodorants, die nur unangenehme Körpergerüche überdecken, hemmen diese Produkte aktiv die Schweissbildung.
- Tragen Sie ausserdem atmungsaktive Kleidung aus Naturmaterialien. Baumwolle, Leinen und Merinowolle nehmen Feuchtigkeit besser auf und lassen Luft zirkulieren. Dadurch wird ein Hitzestau unter der Kleidung vermieden.
- Vermeiden Sie Kunstfasern, insbesondere bei Sport und Hitze. Polyester und ähnliche Stoffe speichern Schweiss, fördern unangenehme Gerüche und trocknen schlechter – vor allem in empfindlichen Körperzonen.
- Waschen Sie Kleidung nach dem Tragen sofort. Besonders Unterwäsche, T-Shirts und enge Kleidung sollten nicht wieder in den Schrank gelegt, sondern direkt gewaschen werden, da sich sonst geruchsbildende Bakterien bilden.
- Behandeln Sie Kleidung mit Schweissgeruch gezielt vor. Dafür können Sie eine Mischung aus Essig und lauwarmem Wasser im Verhältnis 4:1 verwenden, um die Textilien einzuweichen. Waschen Sie die Kleidung anschliessend bei hoher Temperatur, um selbst tiefsitzende Schweissgerüche zu entfernen.
- Wenn nötig, können Sie gewaschene Kleidung im Gefrierfach lagern. Durch das Einfrieren in luftdichten Beuteln über Nacht werden Bakterien abgetötet. Das ist ideal für Kleidung, die auch nach dem Waschen noch müffelt.
- Trinken Sie über den Tag verteilt ausreichend Wasser. Bei Dehydration wird der Schweiss konzentrierter und riecht dadurch intensiver. Mindestens 1.5 bis 2 Liter täglich helfen, Gerüche zu reduzieren und den Kreislauf zu stabilisieren.
- Beobachten Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten bei starkem Körpergeruch. Nahrungsmittel wie knoblauchhaltige Speisen, Curry, Speisezwiebeln, rotes Fleisch und Chili beeinflussen den Schweissgeruch – oft noch Tage später.
- Integrieren Sie geruchsneutralisierende Lebensmittel in Ihren Alltag. Essen Sie zum Beispiel Zitrusfrüchte, Petersilie, Basilikum, Äpfel oder trinken Sie grünen Tee. Diese Nahrungsmittel wirken sich positiv auf den Eigengeruch aus, da sie von innen heraus regulierend wirken.
- Stärken Sie zudem Ihre Darmflora mit probiotischer Kost. Ein gesunder Darm kann unangenehme Ausdünstungen des Körpers vermindern. Joghurt, Kefir oder fermentiertes Gemüse unterstützen die Balance im Verdauungssystem.
- Um eine mögliche Bromhidrose oder Krankheiten der apokrinen Drüsen auszuschliessen, sollte riechender Achselgeruch, Mundgeruch oder auffälliger Atem ärztlich abgeklärt werden. Oft steckt ein Problem mit Androstenon dahinter.
- Setzen Sie ätherische Öle wie Rosmarin- oder Zitronenöl gezielt ein. Rosmarinöl wirkt antibakteriell und erfrischt die Haut. Ob als Badezusatz oder direkt auf die Achseln getupft: Es reduziert Körpergeruch sanft und wirksam.
Manchmal sagt der Körper mehr aus als Worte – auch durch seinen Eigengeruch. Wer aufmerksam ist, kann diese Signale frühzeitig erkennen und entsprechend handeln.