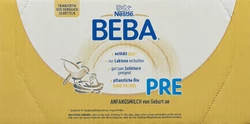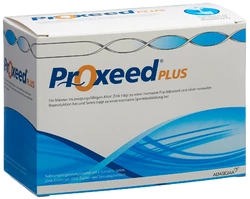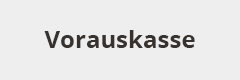So regulieren Sie Ihre weibliche Gesundheit
editorial.overview
Was sind Phytoöstrogene?
Der Begriff Phytoestrogene ist eine Zusammensetzung aus dem griechischen Wort „phyto” für „Pflanze” und „estrogen” für „Östrogen”. Östrogen ist ein wichtiges Hormon, das im weiblichen Körper für die Regulierung des Menstruationszyklus und die Steuerung der Empfängnis verantwortlich ist. In geringen Mengen wird es aber auch im männlichen Körper gebildet. Dort spielt es eine Rolle im Knochen- und Fettstoffwechsel, bei der Gesundheit von Prostata und Gefässen sowie bei der Fruchtbarkeit. Phytoöstrogene sind eine vielfältige Gruppe von Pflanzenstoffen, die in ihrer chemischen Struktur dem Sexualhormon 17-beta-Östradiol ähneln, das als besonders wirksamer Vertreter der körpereigenen Östrogene gilt.
Phytoöstrogene erfüllen in der Pflanze eine Vielzahl von Funktionen, indem sie als Abwehrstoffe gegen Krankheitserreger wirken und für die Entwicklung der Pflanze von entscheidender Bedeutung sind. Für die Kommunikation zwischen Pflanzen und nützlichen Mikroorganismen sowie für den Informationsaustausch zwischen verschiedenen Pflanzen sind sie wichtige Signalstoffe. Der Gehalt an Phytoöstrogenen in Pflanzen steigt unter ungünstigen Bedingungen an. Dies kann z.B. durch widrige Wachstumsbedingungen wie starke Trockenheit oder Kälte, durch Schädlingsbefall oder durch Beschädigungen der Pflanze verursacht sein.
Welche Produkte mit Phytoöstrogenen integrieren Sie heute in Ihre Ernährung?
Welche Hauptgruppen von Phytoöstrogenen gibt es?
Phytoöstrogene werden in zwei Hauptgruppen eingeteilt: Flavonoide (wie Isoflavone, Coumestane, Prenylflavonoide) und Nicht-Flavonoide (wie Lignane und Resveratrol). Besonders die Isoflavone, die vor allem in Soja und Sojaprodukten enthalten sind, werden intensiv erforscht. Der Gehalt an Phytoöstrogenen in Pflanzen kann durch Umweltfaktoren wie Trockenheit, Kälte oder Schädlingsbefall beeinflusst werden.
editorial.facts
- Um täglich 500 mg Resveratrol zu sich zu nehmen, müsste man entweder 185 Liter Rotwein trinken (der nur 0.27 mg pro 100 ml enthält) oder 17 kg Cranberries essen (die 3 mg pro 100 g enthalten). Diese Mengen sind jedoch unrealistisch hoch.
- In der traditionellen asiatischen Ernährung verzehren die Menschen täglich etwa 70 bis 150 Gramm Soja oder Sojaprodukte, so die Forscher. Dies entspricht etwa 30 bis 60 Milligramm Isoflavonen pro Tag. Demgegenüber liegt die durchschnittliche tägliche Aufnahme von Isoflavonen in der westlichen Ernährung, wie sie in Europa üblich ist, nur bei etwa 2.5 Milligramm.
- Bei manchen Männern, die regelmässig Bier trinken und übergewichtig sind, kann es zu einer Vergrösserung der Brust kommen, auch Gynäkomastie genannt. Der Grund dafür ist, dass Fettzellen die Fähigkeit haben, männliche Androgene in weibliche Östrogene umzuwandeln. Bei Biertrinkern verstärkt sich dieser Effekt, was eine Erhöhung des Östrogenspiegels zur Folge haben kann. Somit gilt als gesichert, dass regelmässiger Bierkonsum den Hormonspiegel beeinflussen und damit auch körperliche Veränderungen hervorrufen kann.
Was beeinflusst die Wirkung von Phytoöstrogenen im Körper?
Es ist möglich, dass zwei Menschen, welche exakt die gleiche Menge an Phytoöstrogenen zu sich nehmen, trotzdem unterschiedliche Mengen an aktiven Stoffwechselprodukten dieser Pflanzenstoffe im Blut haben. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Darmflora, welche die Phytoöstrogene in für den Menschen besser verdauliche Substanzen, so genannte Metaboliten, umwandelt. So können sich bei regelmässigem Verzehr isoflavonreicher Lebensmittel Bakterien im Darm vermehren, die in der Lage sind, diese Pflanzenstoffe abzubauen – vorausgesetzt, diese Bakterienarten sind überhaupt im Darm vorhanden.
Phytoöstrogene können sich an körpereigene Östrogenrezeptoren binden. Diese Rezeptoren befinden sich beispielsweise in den Geschlechtsorganen, im Knochengewebe und im Zytoplasma bestimmter Zellen. Der Vorgang folgt dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, bei dem die Östrogene bzw. Phytoöstrogene zunächst die Zellmembran durchdringen und sich dann im Zytoplasma an den Östrogenrezeptor binden.
Nach dieser Bindung können Phytoöstrogene Östrogenrezeptoren entweder hemmen (antiöstrogene Wirkung) oder aktivieren (östrogene Wirkung). Durch diesen Mechanismus haben die Pflanzenstoffe einen Einfluss auf die biologischen Signale im Körper, die durch Östrogene beeinflusst werden. Die Wirkung, die von der Bindung der Phytoöstrogene an die Östrogenrezeptoren ausgeht, wird unter anderem von der Menge an körpereigenen Östrogenen beeinflusst, die zu diesem Zeitpunkt im Körper produziert werden. Körpereigene Östrogene binden sich deutlich stärker an Östrogenrezeptoren als Phytoöstrogene, was zu einer stärkeren östrogenen Wirkung führt.
Bei erhöhtem Östrogenspiegel konkurrieren die Phytoöstrogene mit körpereigenen Östrogenen um die Bindungsstellen der Rezeptoren. Der Östrogeneffekt ist dann zwar vorhanden, aber deutlich schwächer, als wenn körpereigenes Östrogen an die Zelle andockt. Auf diese Weise wird die Wirkung der körpereigenen Östrogene vermindert, was zu einer antiöstrogenen Wirkung führt. Im Gegensatz dazu wirken Phytoöstrogene östrogenartig, wenn der Östrogenspiegel niedrig ist, wie zum Beispiel in den Wechseljahren.
Können Phytoöstrogene das Krebsrisiko beeinflussen?
Ob Phytoöstrogene in das Hormonsystem eingreifen, das Brustkrebsrisiko erhöhen und bei Männern zu einer Verweiblichung führen können, ist umstritten. In Studien wurden verschiedene Mechanismen aufgezeigt, durch die z.B. Isoflavone aus Soja vor Krebs schützen können. So kann der Verzehr von Sojaprodukten bestimmte Abwehrzellen, sogenannte zytotoxische T-Zellen, aktivieren. Diese sind in der Lage, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. Phytoöstrogene unterstützen zudem den programmierten Zelltod von Krebszellen, senken das Metastasierungsrisiko und mildern Nebenwirkungen von Bestrahlungen und Chemotherapien.
Es gibt Hinweise dafür, dass Soja nicht nur bei Brustkrebs, sondern auch bei anderen Krebsarten wirksam ist. Zahlreiche Studien im Zusammenhang mit Prostatakrebs zeigen, wie der Verzehr von Soja die Entstehung von Prostatakrebs verhindern und das Fortschreiten von Prostatakrebs hemmen kann. Der regelmässige Verzehr von Sojaprodukten wie Tofu ist für Männer in der Regel unbedenklich und führt nicht zu einer Verweiblichung. Im Gegenteil, es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass dies positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Prostata hat.
Die krebsfördernde oder -hemmende Wirkung der Isoflavone hängt stark von ihrer Form ab. In Vollsojaprodukten wie Tofu, Sojamilch oder Tempeh wirken die Isoflavone zusammen mit anderen Pflanzenstoffen mehrfach krebshemmend. Sogar bei östrogenabhängigem Brustkrebs zeigt ein moderater Verzehr solcher Vollsojaprodukte krebshemmende Effekte. Isoflavone als Nahrungsergänzung in hoher Konzentration können jedoch krebsfördernde Gene aktivieren und sind daher mit Vorsicht einzunehmen.
Wie wirken Phytoöstrogene bei Wechseljahresbeschwerden und auf das Herz-Kreislauf-System?
Der Verzehr von phytoöstrogenhaltigen Lebensmitteln kann sich auch bei Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewallungen und Scheidentrockenheit günstig auswirken. Studien mit Frauen zwischen Ende 30 und Mitte 60 haben gezeigt, dass die Einnahme von Isoflavonen aus Soja die Hautelastizität erhöht und die Faltentiefe verringert.
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass der tägliche Verzehr von Sojaprotein das als herz- und gefässschädigend geltende LDL-Cholesterin senkt und gleichzeitig das als „gesund“ geltende HDL-Cholesterin erhöht.
So profitieren Sie von Phytoöstrogenen: Die wirksamsten Tipps
- Phytoöstrogene kommen in über 300 Pflanzen vor, darunter Rotklee, Hopfen, Rhapontikrhabarber, Salbei und Süssholzwurzel. Diese Heilpflanzen können als Tee, Tinktur oder Extrakt verwendet werden.
- Soja und Sojaprodukte enthalten hohe Mengen an Isoflavonen, wobei die Gehalte in Sojabohnen und Sojaprodukten zwischen 47 und 142 mg pro 100 g Frischprodukt schwanken. Im Vergleich dazu liegen die Isoflavongehalte verschiedener Gemüsesorten zwischen 0.002 und 0.575 mg pro 100 g. Es gibt also gute Gründe, Sojaprodukte in den Speiseplan zu integrieren. Achten Sie beim Kauf von Sojaprodukten auf Bio-Qualität So vermeiden Sie glyphosatbelastete Sojaprodukte.
- Lignane sind nach den Isoflavonen die zweitwichtigste Phytoöstrogengruppe in unserer Nahrung. Sie kommen zwar in vielen Pflanzen vor, doch sind die Mengen in der Regel gering. Sesamsamen sind eine reiche Quelle mit Gehalten von 405 bis 1178 mg pro 100 g Frischmasse. Auch Leinsamen weisen mit 379.4 mg pro 100 g und Kürbiskerne mit 265 mg pro 100 g hohe Gehalte auf. Bei Nüssen schwanken die Gehalte bis 0.198 mg pro 100 g, während sie bei Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse und Getreide oft noch geringer sind.
- Prenylflavonoide kommen in unserer Nahrung nur selten vor. Hopfen ist eine reiche Quelle für diese Phytoöstrogene, die auch in verschiedenen Biersorten enthalten sind. Der Gehalt an Prenylflavonoiden in verschiedenen Biersorten schwankt zwischen 0 und 0.95 mg pro 100 ml. Alkoholfreies Bier enthält nur etwa 0.02 mg pro 100 ml.
- Resveratrol ist ein Phytoöstrogen, das vor allem aus Rotwein bekannt ist. Eine wirksame Dosierung von Resveratrol liegt bei etwa 500 bis 1500 mg pro Tag. Solche Mengen sind mit normaler Nahrung kaum erreichbar. Daher wird empfohlen, Resveratrol als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, wenn man von den möglichen gesundheitlichen Vorteilen profitieren möchte.
- Reich an Phytoöstrogenen sind Blumenkohl, Broccoli, Rosenkohl, Kohlrabi und Grünkohl. Ausserdem enthalten sie viele weitere Vitamine und Mineralstoffe, die für den Hormonhaushalt wichtig sind. Kreuzblütler sollten daher täglich auf den Tisch.
- Auch Trockenfrüchte enthalten Phytoöstrogene. Die höchsten Gehalte werden in getrockneten Aprikosen (445 μg / 100 g), Datteln (330 μg / 100 g), Pflaumen (184 μg / 100 g) und Rosinen (30 μg / 100 g) gefunden. Trockenfrüchte sollten jedoch nur in geringen Mengen verzehrt werden, da sie auch viel Fruchtzucker enthalten.
- Beeren sind wahre Kraftpakete, reich an Antioxidantien, Nahrungsfasern und Phytoöstrogenen. Das gilt vor allem für die roten Früchte wie Erdbeeren, Preiselbeeren, Cranberries und Himbeeren. Auch wenn sie gerade nicht in der Saison sind, können Sie diese Früchte ohne Bedenken auch in tiefgefrorenem Zustand kaufen und geniessen.
- Für gesunde postmenopausale und perimenopausale Frauen gelten folgende Dosierungen von Nahrungsergänzungsmittel als ausreichend sicher: bis zu 100 mg/d Isoflavone aus Soja bei bis zu zehnmonatiger Einnahmedauer, bis zu 43.5 mg/d Isoflavone aus Rotklee bei bis zu dreimonatiger Einnahmedauer. Grundsätzlich ist es aber ratsam, Phytoöstrogene in Form von pflanzlichen Lebensmitteln zu sich zu nehmen und Isoflavon-Präparate nur nach Rücksprache mit dem Arzt zu verwenden.
In einem vollwertigen Lebensmittel entfalten die Phytoöstrogene ihre volle Wirkung, indem sie sich mit zahlreichen anderen Pflanzenstoffen verbinden. So entsteht eine kraftvolle Synergie, die sich bei verschiedenen Krankheitsbildern als äusserst nützlich erwiesen hat.